Inhalt
Deutsches Museum

Dazwischen nur die Isar: Geburtstagsgruß von der DPMA-Dachterrasse an das Deutsche Museum
Schatzkammer und Inspirationsquelle: Das DPMA gratuliert seinem Nachbarn
Schatzkammer der Technikgeschichte, Erklärwerkstatt für den Forschungsnachwuchs, Inspirationsquelle für Erfinderinnen und Erfinder – wollte man die gesellschaftliche Bedeutung des Deutschen Museums annähernd vollständig erfassen, müsste man diese Aufzählung noch um viele Aspekte erweitern. Daneben ist die altehrwürdige und gleichzeitig zukunftsweisende Institution an der Münchner Isar für das DPMA vor allem auch eins: ein liebgewonnener und hochgeschätzter Nachbar!
Unvergessen bleibt im DPMA die Zeit, in der beide Institutionen sogar gemeinsam untergebracht waren: 1949 war der Sitz des Patentamts von Berlin nach München verlegt worden. Mangels eigener Räumlichkeiten nahm das Amt seine Arbeit zunächst im Deutschen Museum auf.
Am 7. Mai 2025 jährte sich die Eröffnung des Deutschen Museums auf der Münchner Museumsinsel zum 100. Mal – und das DPMA feierte mit: „Neugier wecken, erklären, inspirieren – kaum einer Institution gelingt es so gut, Menschen für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, wie dem Deutschen Museum“, betonte DPMA-Präsidentin Eva Schewior. „Damit ist das Haus von unschätzbarem Wert für unsere Bildungslandschaft, aber auch für Forschung und Entwicklung und damit für den Innovations- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Vom gegenüberliegenden Ufer der Münchner Isar gratulieren wir unserem Nachbarn zum 100. Jubiläum und zu dieser großartigen Leistung!“
Dass die beiden Institutionen inhaltlich eng miteinander verbunden sind, liegt auf der Hand. Einer der berühmtesten deutschen Erfinder, Artur Fischer (siehe unten), hat diesen Zusammenhang der Überlieferung nach anschaulich hergestellt: Im Deutschen Museum hole er sich seine Inspiration; die daraus entstehenden Erfindungen lasse er sich dann gegenüber im Patentamt schützen, soll er gesagt haben.
Fakt ist: Im Deutschen Museum kann man unzählige Innovationen bewundern, die patentgeschützt sind oder es mal waren. Einige bekannte Beispiele, die Sie zum Teil auch in unserer Postergalerie finden, haben wir für Sie zusammengestellt:
Automobil
Kutsche ohne Pferde
Eine der bekanntesten deutschen Erfindungen ist der Benz Patent-Motorwagen Nummer 1. Der „Motorwagen“ gilt als erstes praxistaugliches Automobil; Carl Friedrich Benz erhielt darauf 1886 ein Patent des Kaiserlichen Patentamts ( ![]() DE37435). Ein Modell davon ist im Deutschen Museum zu besichtigen und dürfte auch dort eines der berühmtesten Ausstellungsstücke sein.
DE37435). Ein Modell davon ist im Deutschen Museum zu besichtigen und dürfte auch dort eines der berühmtesten Ausstellungsstücke sein.
Über lediglich einen Hebel konnte der Fahrer oder die Fahrerin den Wagen in Gang setzen, abbremsen sowie zum Stillstand bringen. Zu Berühmtheit gelangte mit der Erfindung nicht nur Carl Friedrich, sondern auch seine Frau Bertha Benz. Zwei Jahre später unternahm sie – allerdings mit einem etwas verbesserten Nachfolgemodell – mit ihren beiden Söhnen und ohne Wissen ihres Mannes eine waghalsige, rund 100 Kilometer lange Fahrt. So bewies sie der damals noch an Pferdekutschen gewöhnten Öffentlichkeit die Praxistauglichkeit des Automobils – und ebnete so gewissermaßen der deutschen Automobilbranche den Weg.
Fischer-Dübel

Der Fischer-Dübel
Feste Verbindungen
Im Deutschen Museum hole er sich die Inspiration, im Deutschen Patent- und Markenamt die Patente. So oder so ähnlich soll sich Artur Fischer zu den beiden benachbarten Institutionen an der Isar geäußert haben. Dem Deutschen Museum war Fischer über Jahrzehnte als Förderer sehr verbunden, insbesondere das Kinderreich lag ihm am Herzen.
Artur Fischer, der 2016 starb, gilt als Deutschlands produktivster Erfinder: 2252 Patente und Gebrauchsmuster meldete er beim DPMA an. Sein 1958 patentierter Spreizdübel ( ![]() DE1097117A) machte den Tüftler aus Tumlingen (Baden-Württemberg) weltweit bekannt. Im größten Technikmuseum der Welt ist der Spreizdübel in der Bautechnik-Ausstellung zu sehen. Das Geniale am Spreizdübel kurz skizziert: Beim Eindrehen einer Schraube spreizen sich die beiden Dübelhälften im Bohrloch auf. Dabei pressen sich Sperrzungen und Zähne des Dübels elastisch gegen die Bohrlochwand und verhindern so ein Mitdrehen des Dübels. Die sägezahnförmigen Einschnitte, die das verdrängte Wandmaterial aufnehmen, erhöhen die Festigkeit der Verbindung.
DE1097117A) machte den Tüftler aus Tumlingen (Baden-Württemberg) weltweit bekannt. Im größten Technikmuseum der Welt ist der Spreizdübel in der Bautechnik-Ausstellung zu sehen. Das Geniale am Spreizdübel kurz skizziert: Beim Eindrehen einer Schraube spreizen sich die beiden Dübelhälften im Bohrloch auf. Dabei pressen sich Sperrzungen und Zähne des Dübels elastisch gegen die Bohrlochwand und verhindern so ein Mitdrehen des Dübels. Die sägezahnförmigen Einschnitte, die das verdrängte Wandmaterial aufnehmen, erhöhen die Festigkeit der Verbindung.
Magnetschwebebahn

Das "Prinzipfahrzeug"
Schweben wie auf Schienen
Der damalige Bundesverkehrsminister Georg Leber nahm als Testpilot im Führersitz Platz, dann kam das neuartige Gefährt langsam in Bewegung: Auf einer gut 600 Meter langen Teststrecke starte am 6. Mai 1971 in Ottobrunn bei München das sogenannte Prinzipfahrzeug der Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH zu seiner Jungfernfahrt – auf einem „wandernden Magnetfeld, das wie ein Kissen unter dem Fahrzeug liegt“, wie der Bayerische Rundfunk damals berichtete. Es war die weltweit erste personentragende Magnetschwebebahn.
Das Fahrzeug gehört heute zur Sammlung des Deutschen Museums. Ansehen kann man es sich in der ![]() Lokwelt Freilassing. Das Eisenbahnmuseum wird von der Stadt Freilassing und dem Deutschen Museum gemeinsam betrieben. Großen Anteil an der Technik der ersten Magnetschwebebahn hat die Elektrotechnikingenieurin Eveline Gottzein, die damals als leitende Ingenieurin bei MBB arbeitete. Sie wird unter anderem als Miterfinderin des Patents
Lokwelt Freilassing. Das Eisenbahnmuseum wird von der Stadt Freilassing und dem Deutschen Museum gemeinsam betrieben. Großen Anteil an der Technik der ersten Magnetschwebebahn hat die Elektrotechnikingenieurin Eveline Gottzein, die damals als leitende Ingenieurin bei MBB arbeitete. Sie wird unter anderem als Miterfinderin des Patents ![]() DE2127047C3 geführt. Die zugrundeliegenden Erfindungen dienen dazu, den Abstand einer Magnetschwebebahn zum Fahrweg möglichst optimal zu regeln – eine der größten Herausforderungen bei Magnetschwebebahnen.
DE2127047C3 geführt. Die zugrundeliegenden Erfindungen dienen dazu, den Abstand einer Magnetschwebebahn zum Fahrweg möglichst optimal zu regeln – eine der größten Herausforderungen bei Magnetschwebebahnen.
Projektionsplanetarium
Den Sternen ganz nah
Den Himmel auf die Erde holen: Das weltweit erste Projektionsplanetarium entstand für das Deutsche Museum. Erfinder des künstlichen Sternenhimmels war Walther Bauersfeld, einer der Geschäftsführer der Firma Carl Zeiss in Jena. Er meldete 1922 seine „Vorrichtung zum Projizieren von Gestirnen auf eine kugelförmige Projektionswand“ zum Patent an ( ![]() DE391036 (1,15 MB)).
DE391036 (1,15 MB)).
Oskar von Miller, Gründer und erster Direktor des Deutschen Museums, hatte bereits 1913 bei dem Unternehmen in Thüringen einen entsprechenden Impuls gesetzt. Miller sprach von einer Art „drehbarer Sternenkugel“. Eine authentische Simulation des dynamischen Sternenhimmels war eine ganz neue Idee. 1923 wurde das weltweit erste Projektionsplanetarium im Deutschen Museum in München vorgestellt. Am 7. Mai 1925 nahm das Projektionsplanetarium dauerhaft seinen Betrieb im Deutschen Museum auf. Heute ist es dort selbst Ausstellungsstück. Das Planetarium im Deutschen Museum wird derzeit modernisiert – und 2028 wieder eröffnet.
Zuse-Rechner

Konrad Zuse mit Z3, 1984
Der erste frei programmierbare Computer
Arbeiten des Computerpioniers Konrad Zuse (1910-1995) haben einen festen Platz in der Sammlung des Deutschen Museums: ein Nachbau des Z3, des ersten frei programmierbaren Computers der Welt, und das Original der Weiterentwicklung Z4. Der Z4 begründete die moderne Computerindustrie in Deutschland.
Der Computerpionier Konrad Zuse stellte 1938 mit dem Z1 den ersten frei programmierbaren Computer fertig. Programmsteuerung, Speicher, Gleitkommaarithmetik und Mikrosequenzen: Alle Komponenten moderner Computertechnik waren bereits enthalten. Grundlegend dafür waren „mechanische Schaltglieder“, für die Konrad Zuse bereits 1936 das Patent erhielt ( ![]() DE907948). In Verbindung damit meldete er 1937 ein „Aus mechanischen Schaltgliedern aufgebautes Speicherwerk“ für ein Patent an, das er schließlich 1955 erhielt. Der Z1, der seine Befehle von Lochstreifen erhielt, war nicht besonders zuverlässig. Bis Ende der 50er Jahre folgten laufende Weiterentwicklungen – bis hin zum Z22. Bis 1967 baute die Firma Zuse insgesamt 251 Computer.
DE907948). In Verbindung damit meldete er 1937 ein „Aus mechanischen Schaltgliedern aufgebautes Speicherwerk“ für ein Patent an, das er schließlich 1955 erhielt. Der Z1, der seine Befehle von Lochstreifen erhielt, war nicht besonders zuverlässig. Bis Ende der 50er Jahre folgten laufende Weiterentwicklungen – bis hin zum Z22. Bis 1967 baute die Firma Zuse insgesamt 251 Computer.
Dieselmotor

Der erste Dieselmotor
Von Thermodynamik inspiriert
Rudolf Diesel besuchte als Student Vorlesungen zur theoretischen Thermodynamik bei Carl von Linde – und fand dort die Inspiration für Überlegungen, die letztlich zum Dieselmotor führten.
„Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungskraftmaschinen“: Mit diesem 1892 patentierten Prinzip (DE67207) war einerseits der Grundstein gelegt. Andererseits wird dort ein Motor mit Selbstzündung beschrieben, der in der Praxis nicht funktionierte. Den Fehler beseitigte Rudolf Diesel mit dem Patent ![]() DE82168 (1,14 MB) von 1893. In einem Dieselmotor wird die Luft stark komprimiert, so dass sie sich auf eine Temperatur von etwa 700 bis 900 °C erhitzt. Der dann eingespritzte Kraftstoff entzündet sich selbst und treibt den Kolben an. Der Dieselmotor hat gegenüber dem Ottomotor einen besseren Wirkungsgrad und deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch. Nach dem Bau verschiedener Prototypen präsentierte Diesel 1897 den ersten funktionsfähigen Motor. Der erste Dieselmotor ist heute im Deutschen Museum in der Ausstellung „Energie – Motoren“ zu sehen.
DE82168 (1,14 MB) von 1893. In einem Dieselmotor wird die Luft stark komprimiert, so dass sie sich auf eine Temperatur von etwa 700 bis 900 °C erhitzt. Der dann eingespritzte Kraftstoff entzündet sich selbst und treibt den Kolben an. Der Dieselmotor hat gegenüber dem Ottomotor einen besseren Wirkungsgrad und deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch. Nach dem Bau verschiedener Prototypen präsentierte Diesel 1897 den ersten funktionsfähigen Motor. Der erste Dieselmotor ist heute im Deutschen Museum in der Ausstellung „Energie – Motoren“ zu sehen.
Radar

Empfangsrelais des "Telemobiloskops"
Sehen ohne Sicht
Ebenfalls in der Sammlung des Deutschen Museums befindet sich ein Modell der Sender-Empfänger-Anlage („Telemobiloskop“) des früheren Düsseldorfer Unternehmers Christian Hülsmeyer, die als erstes Radar gilt. 1904 erhielt Hülsmeyer dafür unter dem Titel „Verfahren, um entfernte metallische Gegenstände mittels elektrischer Wellen einem Beobachter zu melden“ ein Patent vom Reichspatentamt ( ![]() DE165546).
DE165546).
Schon als Jugendlicher hatte sich Hülsmeyer für elektromagnetische Wellen interessiert: Bei Experimenten im Physiksaal kam ihm die bahnbrechende Idee, die Reflexion von elektromagnetischen Wellen an Metall zum Erkennen von entfernten metallischen Gegenständen zu nutzen. Eine Schiffskollision auf der Weser wegen Nebels war für ihn das Schlüsselerlebnis, diese Erkenntnis zum Melden von Schiffen zu verwenden. Seine Erfindung sieht vor, elektrische Wellen durch einen drehbaren, trichterförmigen Projektionskasten mit Hohlspiegel und Oszillator in eine bestimmte Richtung auszusenden. Eine sich synchron zum Projektionskasten drehende Scheibe zeigt dem Beobachter an, aus welcher Richtung die reflektierten Wellen kommen, das heißt in welcher Richtung sich ein metallisches Objekt – zum Beispiel ein Schiff – befindet.
Segelflugzeug

Nachbau eines Lilienthal-Doppeldeckers im Deutschen Museum
Otto Lilienthal - Der fliegende Erfinder
Er ist weltberühmt als „Vater der Fliegerei“: Otto Lilienthal (1848-1896). Weniger bekannt ist, dass er ein vielseitiger Erfinder und Ingenieur war, der zusammen mit seinem Bruder Gustav etliche interessante Patente in den verschiedensten Bereichen anmeldete. Aber seine Hauptleistung ist sein Beitrag zur Geschichte der Luftfahrt. Lilienthal erforschte die theoretischen Grundlagen des Fliegens und setzte diese in die Praxis um.
Die ersten Versuche mit selbstgebauten Gleitern aus Weide und Baumwolle fanden 1889 statt. Im Juni 1891 sprang er mit seinem Hängegleiter vom Mühlenberg bei Krielow und glitt etwa 15 Meter weit - die Geburtsstunde der Luftfahrt. Lilienthal entwickelte in der Folge den "Normal-Segelapparat". Dieser faltbare Eindecker hatte eine Flügelfläche von 13 Quadratmetern und eine Spannweite von 6,7 Metern. Er wurde in der "Maschinenfabrik Otto Lilienthal" produziert und fand einige Käufer, die aus der ganzen Welt kamen - das erste in Serie gefertigte Flugzeug der Welt. Lilienthal meldete ihn zum Patent an ( ![]() DE77916A u.a.).
DE77916A u.a.).
U-Boot

Modell des "Brandtaucher"
Stählerner Seehund: „Brandtaucher“, das erste deutsche U-Boot
Weit weg vom Meer, in Dillingen an der Donau, kam U-Boot-Pionier Wilhelm Bauer (1822-1875) zur Welt. Er baute nicht nur das älteste noch erhaltene Unterseeboot der Welt, den „Brandtaucher“, sondern war auch ein Pionier der Wrackbergung. Bauer studierte in Jütland die Bewegungsabläufe des Seehundes. Tatsächlich ähnelte die Form seines U-Bootes einem gemästeten Walross, daher wurde es auch „Eiserner Seehund“ genannt. In Kiel konnte Bauer mit (zu) knappen Mittel sein Unterseeboot bauen. Am 1. Februar 1851 unternahm er die erste und letzte Testfahrt mit dem „Brandtaucher“ im Kieler Hafen. Dabei sank das Boot wegen Materialfehlern, aber die Besatzung konnte sich retten.
Das erste echte deutsche Unterseeboot schien verloren. Bauer baute 1852 zu Werbezwecken ein neues Modell, das heute im Deutschen Museum zu sehen ist. Jahre später wurde der „Brandtaucher“ gehoben und befindet sich heute im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden.
Bauer gab nicht auf und ging nach London, wo es im Gegensatz zu den deutschen Ländern längst ein funktionierendes System des gewerblichen Rechtsschutzes gab. So meldete er seine Erfindung am 25. Mai 1853 beim englischen Patentamt an: „Vessel to be used chiefly under water, and apparatus for propelling, balancing and steering the same“ ( ![]() GB1281; 1853).
GB1281; 1853).
Enigma

"Enigma" im Deutschen Museum
Die Kryptographie und der Krieg
1918 meldete Arthur Scherbius (1878-1929) seinen ersten „Chiffrierapparat“ zum Patent an ( ![]() DE416219). Er enthielt bereits die wesentlichen Elemente der Enigma, die das wichtigste Verschlüsselungsinstrument der deutschen militärischen Kommunikation werden sollte. Sie codierte Texte mit einem System von drei oder mehr rotierenden, austauschbaren Walzen und Steckverbindungen, das theoretisch 158.962.555.217.826.360.000 verschiedene Schlüssel bot. Wie bei einer Schreibmaschine wurden Texte eingetippt, die dann als Buchstabensalat ausgegeben und per Morse-Code gefunkt wurden. Sender und Empfänger benötigten jeweils eine Enigma mit der exakt gleichen Konfiguration, die regelmäßig geändert wurde, und die Codebücher mit den Tagesschlüsseln.
DE416219). Er enthielt bereits die wesentlichen Elemente der Enigma, die das wichtigste Verschlüsselungsinstrument der deutschen militärischen Kommunikation werden sollte. Sie codierte Texte mit einem System von drei oder mehr rotierenden, austauschbaren Walzen und Steckverbindungen, das theoretisch 158.962.555.217.826.360.000 verschiedene Schlüssel bot. Wie bei einer Schreibmaschine wurden Texte eingetippt, die dann als Buchstabensalat ausgegeben und per Morse-Code gefunkt wurden. Sender und Empfänger benötigten jeweils eine Enigma mit der exakt gleichen Konfiguration, die regelmäßig geändert wurde, und die Codebücher mit den Tagesschlüsseln.
Alan Turing (1912-1954) war im Zweiten Weltkrieg der führende Kopf der britischen Codeknacker in Bletchely Park nahe London. Sie fanden Wege zur Entschlüsselung der deutschen Funksprüche. Turing wurde durch die Konstruktion seiner „Bombe“ ein Vater der modernen Computertechnik. Dieser Riesenapparat konnte die Enigma-Codes innerhalb weniger Minuten knacken. Die Alliierten waren somit über alle Schritte der Deutschen informiert. Die Bedeutung dieses Wissensvorsprungs ist kaum zu überschätzen. Die Mathematiker und Kryptoanalytiker von Bletchley Park trugen entscheidend dazu bei, den Krieg zu verkürzen.
Bilder: DPMA, Deutsches Museum, Deutsches Museum, Lokwelt Freilassing, Deutsches Museum, Deutsches Museum/Reinhard Krause, Deutsches Museum, Deutsches Museum Konrad Rainer CC by SA 4.0, Deutsches Museum Christian Illing CC by SA 4.0, Deutsches Museum Christian Illing CC by SA 4.0, Deutsches Museum Konrad Rainer CC by SA 4.0, Deutsches Museum Konrad Rainer CC by SA 4.0
Stand: 15.01.2026
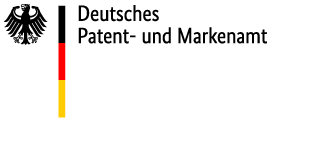


Wir schützen nicht nur Innovationen.
Soziale Medien